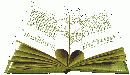
Aktuelles, Wissens- und Bedenkenswertes aus der
Deutschen Esperanto-Bibliothek Aalen

Achtung! Sperrfrist beachten! :
Erscheinungstag von Esperanto aktuell 2016/4
Folge 26: Erneut Thema NS-Raubgut – Restitution immer noch aktuell, auch 70 Jahre nach Kriegsende (0) diese Seiten sind vorerst nur Platzhalter für einen neuen Text aus Esperanto aktuell 2016/Heft4! |
|
Schon kurz nach Manuskriptabgabe(1)
für das vorherige Heft ging folgende Meldung durch die einschlägige Presse:
„Rostock, 18.5.16: Feierliche Restitution in der Aula – Universitätsbibliothek
gibt NS-Raubgut-Bücher an Audrey Goodman aus den USA zurück.“
Was ist denn nun diese Restitution? Der Begriff Restitution geht zurück auf das lateinische Verb restituere = wiederherstellen. Somit ist die Restitution von NS-Raubgut der Versuch, die ursprünglichen Eigentumsverhältnisse wieder herzustellen. In der Zeit des Nationalsozialismus verloren vor allem Juden und andere Verfolgte ihren Besitz unrechtmäßig, so z. B. durch Zwangsverkäufe oder Beschlagnahmungen. Ein Großteil dieser Bücher wurde damals bewusst vernichtet, ein Teil findet sich noch heute in den Beständen deutscher Bibliotheken; denn damals gehörten wissenschaftliche Bibliotheken zu den wenigen Einrichtungen, in denen das Aufbewahren verbotener Literatur erlaubt war. Sie bekamen diese Bücher von der GeStaPo, der Reichstauschstelle oder der Wehrmacht – deklariert als „Geschenke“, „Überweisungen“ oder „alter Bestand“. Wie wir aus leidvoller Erfahrung wissen, zählte man die Bibliothek des Deutschen Esperanto-Instituts nicht dazu; ihr erging es gerade umgekehrt. Davon berichtete ja die Folge im vorherigen Heft. |
Dass Restitution eigentlich für jede rechtsstaatlich denkende Institution selbstverständlich sein müsste,
ergibt sich aus folgender Überlegung: Wenn ein Unrechtsregime (wie man den NS-Staat ja auch gerne
bezeichnet(2))
seine Bürger und deren private Vereinigungen zwingt, ihre Aktivitäten einzuschränken, und von ihnen verlangt,
sie völlig aufzugeben (mit höchstens den Alternativen Untergrund oder Exil), ihnen jegliche Lebensgrundlagen
entzieht, dann kann man sehr wohl an dessen Rechtsstaatlichkeit Zweifel anmelden. Selbst wenn dann dessen
Gerichte aufgrund geltender Gesetze ihre Urteile fällen, wird man diese nicht immer auch als gerecht
anerkennen können und wollen. Wolfgang Schareck, der Rektor der Universität Rostock erklärte: „Wiedergutmachung ist angesichts des Unrechts und Leids, das Menschen erleiden mussten, die von den Nationalsozialisten verfolgt wurden, kaum möglich. Daher sehen wir die Rückgabe der Bücher als einen Akt des Respekts und der Verantwortung, dafür zu sorgen, dass sich so etwas niemals wiederholen darf.“ Robert Zepf, Direktor der Universitätsbibliothek: „Die Bücher sind nur selten von großem materiellem Wert. Für die Familien ihrer früheren Besitzer haben sie aber eine große ideelle Bedeutung – insbesondere dann, wenn es durch die Verfolgung in Deutschland kaum noch Erinnerungsstücke gibt.“ |
|||
|
Information zum Themenkreis rund um Restitution und NS-Raubgut findet man an vielen Stellen im Netz, so auch auf den Seiten der Berliner Staatsbibliothek. Dort(3)) kann man unter anderem lesen, "dass sich in zahlreichen polnischen Bibliotheken … Druckschriften der ehemaligen Preußischen Staatsbibliothek befinden. Weltweit besonders bekannt ist jedoch der Berliner Bestand in der Universitätsbibliothek in Krakau (Berlinka genannt), welche wertvollste Objekte enthält … Da sich Bestände der Staatsbibliothek zu Berlin in polnischen, russischen und anderen Bibliotheken befinden, sind historisch gewachsene und zusammengehörende Sammlungen zerrissen, so dass häufig nur entwertete Büchertorsi sowohl in Berlin als auch in den Bibliotheken Osteuropas vorhanden sind. Die vergleichende Erforschung der oft einmaligen Objekte … ist nur mit großem Aufwand möglich." Natürlich trifft das nur begrenzt auf die heutige Sammlung in Aalen zu. Sie ist historisch neu gewachsen, seit 1949, und mit Sicherheit bedeutsam, weil sie große Teile ihrer nicht mehr frei zugänglichen Teile, die heute in einem Berliner Außenmagazin liegen, durch Spenden und Stiftungen ergänzen konnte. Historisch gesehen wäre sie eigentlich zusammen mit der Berliner Sondersammlung in der Tat eine sehr ansehnliche Einheit, wenn nicht diese NS-bedingte Schenkung nach Berlin erfolgt wäre. Ob diese "Schenkung" aufgrund äußeren Drucks als gleichwertig mit einer Enteignung (und analog daher als Raubgut zu qualifizieren wäre oder als NS-bedingter "Verlust") anzusehen ist, mag uns heute gleichgültig erscheinen, zumal wir als Teil der Esperanto-Movado friedlich gestimmt sind. |
Jedenfalls: die Parallelität dazu hat uns die Berliner Stabi aufgezeigt, sie ist nicht eine Erfindung aus Aalen! Wie leicht oder schwierig es sein kann, eines dieser Originale einzusehen, davon kann sich jeder Fernleihe-Nutzer selbst ein Bild machen; man erlebt da nicht nur Erfreuliches, wie mir schon berichtet wurde. Dabei kann es an vielen Ecken klemmen, und das ist nie nur monokausal zu betrachten; deshalb enthalte ich mich einer abschließenden Beurteilung. Blicken wir mal auf das Exemplar 17 ZZ 592(4)) [Cikado ĉe formikoj : unuakta komedio / E. Labiche kaj E. Legouvé. - Paris : Hachette [u.a.], [1904], 47 S. (Kolekto Esperanta)]! Dort liest man als Anmerkung: "Akzessions-Nr. auf der Rücks. des Titelbl.: P 1936.8873. - Stempel: Bibliothek des kgl. stenographischen Instituts Dresden [überklebt mit] Etikett: Sächsisches Esperanto-Institut Dresden. - Hs. Nummer: Y.f. 164. - Stempel: Königl. Sächs. Esperanto-Bücherei Reg̀a Saksa Esperanto-Biblioteko. - Hs. Nummer: B.a.32.. - Zugang: Akzessionsjournal der Preußischen Staatsbibliothek, Pflicht P 1936.8873 "Esperanto-Institut für das Deutsche Reich Leipzig", inventarisiert als Pflichtexemplar 1937-01-29". Wir wissen, dass es nicht ganz korrekt ist, eine als Geschenk eingegangene Einheit als Pflichtexemplar zu inventarisieren; der Vorgang zeigt uns aber, dass selbst die damaligen Bibliothekare (im Jahr 1937) diese (offizielle) Lesart mit dem "Geschenk" nicht so recht zu glauben vermochten … |
|||
|
Die gleiche Staatsbibliothek Berlin führt uns auch ein Musterbeispiel für den Umgang mit potenziellem NS-Raubgut vor, indem sie einige Exemplare beim Deutschen Zentrum Kulturgutverluste(5) meldete. Ich finde das schon überkorrekt, zumal angesichts der Vielzahl von Objekten und vor allem der Tatsache, dass kaum Aussicht besteht, jemals diese Restitution einem glücklichen Ende zuzuführen. Wegen ihrer Bedeutsamkeit will ich abschließend die dort formulierten Grundsätze noch zitieren: „In der Rechtsnachfolge der Preußischen Staatsbibliothek ist sich die Staatsbibliothek zu Berlin – Stiftung Preußischer Kulturbesitz ihrer Verantwortung bewusst und beschäftigt sich intensiv mit der Problematik von NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut in ihren Sammlungen. … Wenn sich der Verdacht der Beschlagnahme, Enteignung oder eines Notverkaufes bestätigt und das Exemplar eindeutig als das gesuchte identifiziert werden kann, werden die Rechercheergebnisse einschließlich des Sachverhaltes "NS-Raubgut" mittels vertiefter Provenienz-Erschließung im Online-Katalog der Staatsbibliothek, dem StaBiKat, dokumentiert. Dabei werden die in den Büchern vorhandenen Provenienzspuren (Stempel, Exlibris, handschriftliche Besitzeinträge) sowie die Angaben aus den Zugangsbüchern und ggf. den Akten über die Herkunft der Bände (Lieferanten), mögliche Vorbesitzer, den Zeitpunkt und die Art der Erwerbung erfasst, sodass die gesamte Exemplarhistorie im elektronischen Katalog der Staatsbibliothek recherchierbar ist. Ebenso wird im Falle der Restitution oder auch bei Restitutionsverzicht durch den Eigentümer oder seinen Rechtsnachfolger die Sachlage unter Angabe des Zeitpunktes der Rückübertragung bzw. des Datums der Verzichterklärung im Katalog nachgewiesen.“ |
Interessanterweise finden sich in dieser Liste auch Exemplare, welche 1937 nicht in die Sondersammlung 17ZZ.. eingegliedert wurden. Jetzt aber Schluss mit dieser Thematik! Bleibt nur zu hoffen, es möge diesen Zeilen nicht so ergehen, wie es Georg Christoph Lichtenberg (1742 - 1799) über Bücher formuliert hat(6): "Ein Buch ist ein Druckwerk, aus dem die Leser gewöhnlich etwas ganz anderes herauslesen, als der Autor hineingeschrieben hat." |
|||
|
|
|
|||
| Utho Maier | ||||
|
||||

|
Spenden für die
Deutsche Esperanto-Bibliothek
Aalen erbeten!
– Jeder Euro hilft, jeder Tropfen auf den heißen Stein!– oni ja scias, ke eĉ guto malgranda konstante frapanta … - steter Tropfen … … auf das GEA-Konto IBAN DE32 5085 1952 0040 1145 71 (Sparkasse Odenwaldkreis) mit Vermerk „Bibliothek AA“ [s.a. www.esperanto.de/de/spenden] - bildo prenita el https://esperanto-usa.org/en/content/eĉ-guto-malgranda |

|
|
Ist eigentlich schon jemals einer auf die Idee gekommen, dass unsere Deutsche Esperanto-Jugend als Eigentum der EU zu betrachten wäre, weil sie ja schon Tausende an Euro als Fördermittel erhalten hat? Wie sieht es aus, wenn die Kommungen den Breitensport durch Geld unterstützen oder der Staat unsere Olympioniken? |
|||||||||||||||

Einige Zusatzanmerkungen: Wenn ein Unrechtsregime (wie man den NS-Staat ja auch gerne[*] bezeichnet) seine Bürger und deren private Vereinigungen zwingt, ihre Aktivitäten einzuschränken und von ihnen verlangt, sie völlig aufzugeben (mit höchstens den Alternativen Untergrund oder Exil), ihnen jegliche Lebensgrundlagen entzieht, dann kann man sehr wohl an dessen Rechtsstaatlichkeit Zweifel anmelden. Selbst wenn dann dessen Gerichte aufgrund geltender Gesetze zu Urteilen kommen, wird man diese nicht immer als gerecht anerkennen können und wollen. Sehr schnell kommen einem da in der jetzigen Zeit Parallelen in den Sinn, auf die wir als Ausländer (trotz gleicher EU-Mitgliedschaft) kaum Einfluss haben dürften. Wie es im Moment aussieht, werden es die rechtsextremen Braunen im Nachbarland Polen wohl schaffen, das Zamenhofzentrum in Bialystok noch rechtzeitig vor oder pünktlich zum Termin des 100. Todestags von Zamenhof zu liquidieren. Dieses harte Wort dafür werfe man nicht mir vor; denn es kommt nicht aus meiner Feder, sondern es war in der polnischen Presse so zu lesen, in der man auch den Vergleich mit Hitler in fetten großen Lettern deutlich sehen konnte: http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/1,35241,19981665,zamenhof-jak-hitler-radny-wasilewski-nie-widzi-roznicy.html kp. ankaŭ www.liberafolio.org/2016/zamenhof-centro-en-bjalistoko-malfondota (letzte Seitenaufrufe im Netz: 7.5.2016) [*] Das ist jedoch nicht unumstritten. Es wird auch argumentiert, eine Gleichsetzung von DDR und NS-Regime mit dem Begriff des Unrechtsstaats sei falsch, da sich dabei die Gefahr einer Verharmlosung der Naziherrschaft aufdränge, die ganz andere Dimensionen des Unrechts erreicht habe. Langformen der Adressen: (1) staatsbibliothek-berlin.de/fileadmin/user_upload/zentrale_Seiten/benutzungsabteilung/pdf/INFO0614.pdf (4) esperanto-bibliothek.gmxhome.de/2003/geschich.htm (5) esperanto-bibliothek.gmxhome.de/broshur/espbib_eo/vieno2007/aktoj_viena_kolokvo_Aalen_100.pdf#9 katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=8196 (6) kulturgutverluste.de/images/projekte/421px-Sächsisches_Esperanto-Institut_Dresden_Etikett_DE-1_17ZZ592.jpg (7) provenienz.gbv.de/Datei:Bein_Kazimierz_Autogramm_DE-1_17ZZ957.jpg (8) http://stabikat.de/DB=1/SET=38/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8518&SRT=YOP&TRM=Esperanto-Institut+für+das+Deutsche+Reich+Leipzig, falls gemeldet wird "es wurde nichts gefunden.", dann nochmals auf Suchen klicken! (9) stabikat.de/DB=1/SET=20/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8518&SRT=YOP&TRM=Sächsisches+Esperanto-Institut+Leipzig+Königlich-Sächsische+Esperanto-Bücherei falls gemeldet wird "Leider keine Treffer.", dann nochmals auf Suchen klicken! (0) (a) Über viele Jahre hat Lichtenberg ab 1764 in Schreibheften, von ihm selbst ironisch „Sudelbücher“ genannt, in aphoristischer Form unzählige Gedankensplitter (spontane Einfälle, Lesefrüchte, Reflexionen zu fast allen Wissensgebieten und naturwissenschaftliche Feststellungen) notiert, die posthum veröffentlicht wurden. Von ihm sind etwas auch diese: „Wenn ein Buch und ein Kopf zusammenstoßen und es klingt hohl, ist das allemal im Buch?” (erschienen in Sudelbücher I. München 1968, S. 291, Aph. D 399) „Das Buch, das in der Welt am ersten verboten zu werden verdiente, wäre ein Katalogus von verbotenen Büchern.” (Sudelbücher, Heft G, S. 135) „Mehr als das Gold hat das Blei die Welt verändert, und mehr als das Blei in der Flinte das Blei im Setzkasten.” – und hier die Story dazu: einstmals im Monat September des Jahres 1779, als in einem Göttinger Buchladen der dort zufällig anwesende Schriftsteller und geistvolle Satiriker Georg Christoph Lichtenberg unvorhersehbar von dem plötzlich um ihn herumtänzelnden Buchhändler beinahe kniefällig mit dem folgenden Ansinnen bestürmt worden war: Er, der anbetungswürdige Meister des Aphorismus, er möge ihm doch bitte - koste es denn, was es wolle - liebenswürdigerweise ein wahrlich werbewirksames Sprüchlein für die Schaufensterauslage gestalten. - Tatsächlich hat sich der Autor Lichtenberg dereinst "breitschlagen lassen" und schon einige Tage später dem Göttinger Buchhändler einen durchaus erfolgversprechenden Werbetext überreicht, mit dem folgenden Wortlaut: „Nun ja, wer zwei paar Hosen sein eigen nennt, der mache nun selbstkritisch und neugierig werdend eine davon zu Geld! - Um sich dann unverweilt Bücher beschaffen zu können.” |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||